Adoptivkinder
Pflegekinder
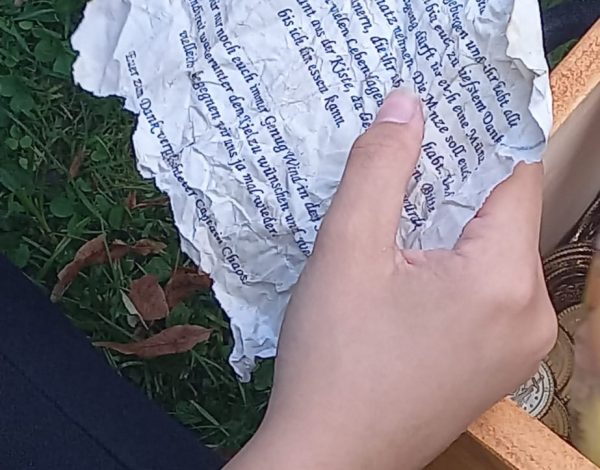
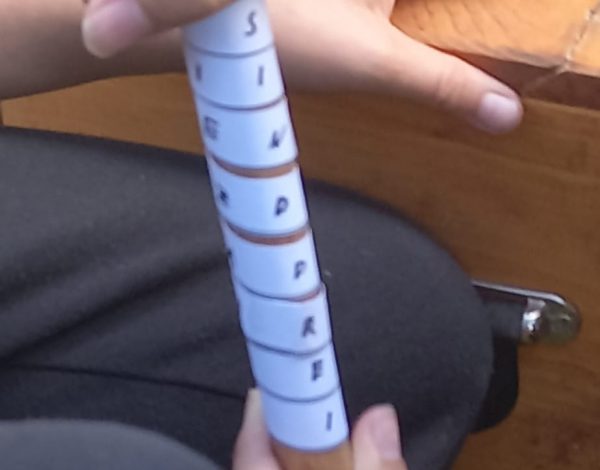
Warum profitieren Pflege und Adoptivkinder besonders von Erlebnispädagogischen Aktionen?
Pflegekinder haben oft schon in frühster Kindheit herausfordernde und belastenden Erfahrungen durchlebt. Viele dieser Kinder haben Misshandlung; Missbrauchs und Gewalterfahrungen erlebt, haben Eltern, die sie vernachlässigt haben oder an Suchterkrankungen oder Psychische Einschränkungen leiden. Meist waren das auch die Gründe für die Herausnahme der Kinder aus der Herkunftsfamilien. Diese Biografie begleitet sie ihr Leben lang und bringt zusätzliche Herausausforderungen mit sich. So haben viele Kinder dadurch geringes Selbstwertgefühl, und weniger Zugang zu ihrer eigen Gefühlswelt. Auch die Selbstwahrnehmung kann dadurch verändert sein. So zeigen sich Verhaltensauffälligkeiten zum Beispiel ADHS, gesteigertes Aggressionspotential und andere Verhaltensauffälligkeiten Häufiger. Manche Kinder haben durch ihre Geschichte bekannte oder unbekannte Traumata erlebt und versuchen diese Zu verarbeiten. Ein Leben als Pflegekind führt zu einem Gefühl geringer Selbstwirksamkeit aufgrund der Menge an Fachkräfte, wie Jugendamt, Gerichte, Therapeuten, die Pflegefamilien, die Herkunftsfamilie die alle Teil ihres Alltags sind. In der Pubertät und der damit verbundenen Identitätsentwicklung, einer Zentralen Entwicklungsaufgabe jedes Jugendlichen (Lohaus 2018, S. 31), kommt dann die nächste Herausforderung, sich mit Zwei Familienmodellen, die oftmals sehr unterschiedlich sind, auseinandersetzen und sich von diesem Ab zu nabeln, um zu einer eigenständigen Persönlichkeit zu werden. Zusätzlich sind Pflegekinder wie oben beschreiben häufiger mit Kritischen Entwicklungsaufgaben beschäftigt, (Lohaus 2018, S. 34). All diese Gründe können dazu führen, dass Pflegekinder geringer Resilienz entwickeln, die sie in ihrem Späteren Leben beeinträchtigt. Hier versuchen wir mit der Erlebnispädagogik anzusetzen und die Pflegekinder mit genügend Schutzfaktoren wie, „Soziale Unterstützung[,] Positive Beziehungen zu einem Erwachsenem außerhalb der Familie[, oder] Freundschaftsbeziehungen zu prosozialen Gleichaltrigen Menschen“(Lohaus 2018, S. 36) auszustatten um ihnen ein Bewältigen ihrer Entwicklungsaufgaben zu ermöglichen und sie zu eigenständigen Persönlichkeiten werden zu lassen, die Selbstbestimmt durch ihr Leben gehen können.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Pflegekinder haben oft schon in frühster Kindheit herausfordernde und belastenden Erfahrungen durchlebt. Viele dieser Kinder haben Misshandlung; Missbrauchs und Gewalterfahrungen erlebt, haben Eltern, die sie vernachlässigt haben oder an Suchterkrankungen oder psychischen Einschränkungen leiden. Meist waren das auch die Gründe für die Herausnahme der Kinder aus der Herkunftsfamilien. Diese Biografie begleitet sie ihr Leben lang und bringt zusätzliche Herausforderungen mit sich. So haben viele Kinder dadurch geringes Selbstwertgefühl, und weniger Zugang zu ihrer eigen Gefühlswelt. Auch die Selbstwahrnehmung kann dadurch verändert sein. So zeigen sich Verhaltensauffälligkeiten, zum Beispiel ADHS, gesteigertes Aggressionspotential und andere Verhaltensauffälligkeiten häufiger. Manche Kinder haben durch ihre Geschichte bekannte oder unbekannte Traumata erlebt und versuchen diese zu verarbeiten. Ein Leben als Pflegekind führt zu einem Gefühl geringer Selbstwirksamkeit aufgrund der Menge an Fachkräfte, wie Jugendamt, Gerichte, Therapeuten, die Pflegefamilien, die Herkunftsfamilie die alle Teil ihres Alltags sind. In der Pubertät und der damit verbundenen Identitätsentwicklung, einer zentralen Entwicklungsaufgabe jedes Jugendlichen (Lohaus 2018, S. 31), kommt dann die nächste Herausforderung, sich mit zwei Familienmodellen, die oftmals sehr unterschiedlich sind, auseinandersetzen und sich von diesem ab zu nabeln, um zu einer eigenständigen Persönlichkeit zu werden. Zusätzlich sind Pflegekinder wie oben beschreiben häufiger mit kritischen Entwicklungsaufgaben beschäftigt, (Lohaus 2018, S. 34). All diese Gründe können dazu führen, dass Pflegekinder geringer Resilienz entwickeln, die sie in ihrem späteren Leben beeinträchtigt. Hier versuchen wir mit der Erlebnispädagogik anzusetzen und die Pflegekinder mit genügend Schutzfaktoren wie, „Soziale Unterstützung[,] Positive Beziehungen zu einem Erwachsenem außerhalb der Familie[, oder] Freundschaftsbeziehungen zu prosozialen gleichaltrigen Menschen“(Lohaus 2018, S. 36) auszustatten, um ihnen ein Bewältigen ihrer Entwicklungsaufgaben zu ermöglichen und sie zu eigenständigen Persönlichkeiten werden zu lassen, die Selbstbestimmt durch ihr Leben gehen können.
Welchen Beitrag kann die Erlebnispädagogik leisten?
Aus vielen Untersuchungen zur Lernpsychologie wissen wir, dass am besten lernt, wer das Lerngeschehen selbst in die Hand nimmt. Überall ist es notwendig, eine größtmögliche Selbststeuerung des Lernens zu erreichen. Weiterhin ist Lernen ein sozialer Prozess. Lernen basiert immer auf der Interaktion, wenigstens auf der zwischen Lehrer und Schüler. Letztlich aber ist Lernen immer eingebettet in eine Dynamik der Gruppe, und wer diese Dynamik der Gruppe nicht beachtet, vergibt Lernchancen. (Michl 2020, S. 49) Durch die beschriebene Maßnahmen können Pflegekinder sich selbst kennenlernen, untereinander Kontakt aufbauen und lernen, dass sie mit ihrer Biografie nicht alleine sind. Zusätzlich können sie durch den ganzheitlichen Ansatz der Erlebnispädagogik, durch den viele Gefühle wie Frust bei schweren Übungen oder Freude bei Erfolg, ihre Gefühlswelt spüren, wahrnehmen und diese in geschütztem Rahmen ausdrücken. Weiterhin können die Kinder durch den direkten Zusammenhang zwischen den eigenen Handlungen und den Folgen, ihre Selbstwirksamkeit wahrnehmen. Dies führt auch dazu, dass sie ihr Selbstbewusstsein und ihr kongruentes Handeln gestärkt wird. Durch Übungen, die im Gruppenkontext stattfinden, aber darauf basieren, dass jeder mitmacht, kann das Gefühl der Kinder gestärkt werden, dass sie ein wichtiger Teil der Gruppe sind. Während der Aktion in der Gruppe wird Rücksicht gefordert und Vertrauen gefördert. Wenn (Pflege) Kinder die Möglichkeit haben regelmäßige solche Erfahrungen und Angebote zu erleben, ist dies förderlich für die Resilienz und Lebensgestaltung der Kinder. Daraus folgt Erlebnispädagogik stärkt und fördert Pflegekinder in ganz besonderen Maßen.
Quellen:
- Lohaus, Arnold (2018): Entwicklungspsychologie des Jugendalters. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Michl, Werner (2020): Erlebnispädagogik. 4., aktualisierte Auflage. München: Ernst Reinhardt Verlag (utb Pädagogik | Soziale Arbeit, 3049).
